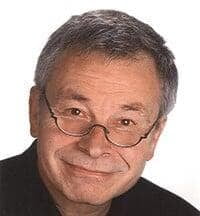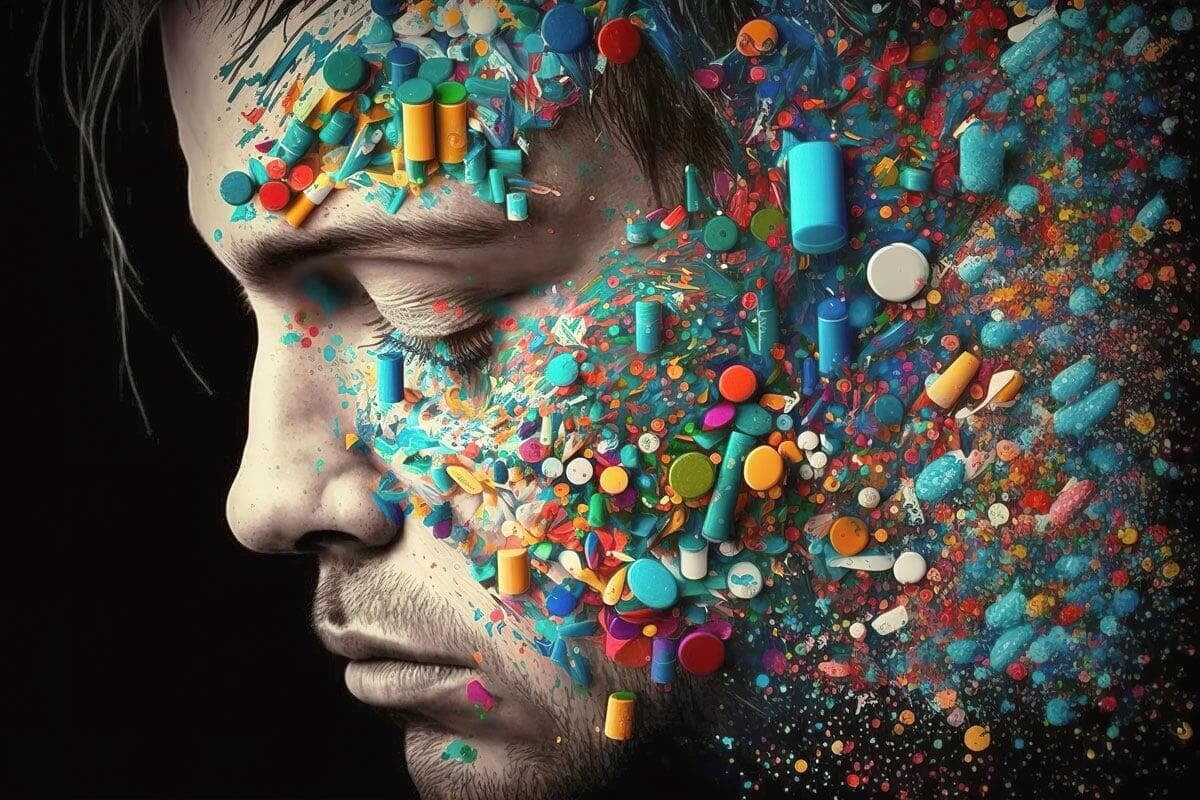
Es ist ungewohnt: Derzeit ist manches Medikament – kurzfristig oder auf längere Zeit – in deutschen Apotheken nicht erhältlich. Kolportiert wird, nahezu 30 Prozent der Rezepte seien betroffen. Für schwerkranke Patientinnen/Patienten ist das bedrohlich. Eine Hauptursache der Lieferstörungen ist wahrscheinlich der harte Preisdruck auf rezeptpflichtige Medikamente, vor allem auf die ohnehin günstigen Generika (Arzneimittel, das den identischen Wirkstoff wie ein ehemals patentgeschütztes Präparat enthält und deshalb genauso wirkt - Anm. d. Redaktion) in unserem Land. Für die meistverordneten Mittel müssen alljährlich Rabattverträge zwischen den Krankenkassen und den Arzneimittelherstellern geschlossen werden. Auf Kassenrezept sollen/können in den Apotheken dann nur die entsprechend preisreduzierten Medikamente abgegeben werden.
„Das steht mir zu"
Um bei, den politisch verordneten Auktionen, mithalten zu können, verlagerten viele einheimische Hersteller ihre Produktion, vor allem von Grundstoffen, in Länder mit niedrigeren Löhnen und vermutlich auch niedrigeren Auflagen. Wesentlich mitbestimmt wurde die Einführung der Rabattverträge von dem Professor für Gesundheitsökonomie und damaligen Staatssekretär im Gesundheitsministerium Dr. Karl Lauterbach. Bundesministerin für Gesundheit war damals, von Januar 2001 bis Oktober 2009, Frau Ulla Schmidt bekannt, aufgrund ihrer Paradigmen: „Das Gerede von der demographischen Katastrophe ist Unsinn", sowie: „Ältere Menschen sind ein wichtiger Faktor für die Marktwirtschaft“.
Auf die Expansion der Pflegewirtschaft und deren Problemen zur Gewinnung von Pflegekräften trifft das durchaus noch zu. Frau Schmidts Statement zum (vollständig nachgezahlten) Einsatz ihres Dienstwagens nahe ihres Urlaubsortes in Spanien: „Das steht mir zu“ wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache sogar zum Satz des Jahres 2009 gewählt. Noch trefflicher hätte man die weiter steigende Anspruchshaltung in unserer Gesellschaft wohl auch nicht wiedergeben können. Davon soll hier aber gar nicht die Rede sein. Es geht um die medizinische Versorgung – mit Medikamenten. Auch da aber spielt die Anspruchshaltung eine Rolle.
Gesundheitskioske?
Hier ist nun Herr Professor Dr. Karl Lauterbach als Gesundheitsminister (seit 12/2021) hochaktiv und mit dem Problem fehlender Arzneimittel – besonders betroffen sind krebskranke Menschen, aber auch Kinder, noch mehr deren Eltern – konfrontiert. Höchst wirksam, gewiss auch publikumswirksam, will er gegen die Engpässe, gegen den Mangel, vorgehen. Die Produktion von Schmerzmitteln, Antibiotika und Fiebersäften soll bis zum technischen Limit erhöht werden, ordnete er bereits an. Und Apotheken sollen nicht nur für die Abgabe, sondern auch für den bedarfsweisen Austausch von Medikamenten zu vergüten sein. Übung dafür gibt es schon wegen der Substitution zur Erfüllung sämtlicher Rabattverträge.
Regelmäßig waren Patientinnen und Patienten dadurch verunsichert. Hoffen wir mal, dass neuerdings nicht allzu viel schief geht. Zumal der Gesundheitsminister Apotheken auf dem Land ohne Apothekerin/ohne Apotheker ermöglichen will. Gleichzeitig Gesundheitskioske (Was auch immer das sein soll? Möchte er da zeitgeistig Gesundheit neben Snacks und Sixpacks offerieren?) einrichten, und Gutscheine für Vorsorgeuntersuchungen in Apotheken (ob mit oder ohne Apothekerin/ Apotheker?) ausgeben, nebenbei auch medizinische Versorgungszentren regulieren. Und Digitalisierung von oben vorantreiben. Herr Lauterbach hat sich viel vorgenommen. Und irgendwie sind da noch die traditionellen Arztpraxen, für die er wenig Empathie, wenig Verständnis zeigt, die gleichwohl nach wie vor die Basis grundlegender medizinischer Versorgung sind. So viel zu den Streiflichtern aktueller Gesundheitspolitik.
Mehrproduktion bis zum technischen Limit
Ganz profan und analog ist da nun Mehrproduktion von Schmerzmitteln, von Antibiotika und von Fiebersäften angesagt. Bis zum technischen Limit. Was ein Knüller. Klar betrachtet, werden dafür eher mehr Grundstoffe aus China und Indien erforderlich sein als weniger. Für die Endproduktion, das Pressen von Tabletten aus den synthetisierten Wirkstoffen, das Bereiten von Fiebersäften, das Abfüllen und Verpacken sollen einheimische Hersteller nun sogar Prämien bekommen. Die irgendwie das Gegenteil zu Rabattverträgen darstellen. Hü und Hott riefen die Kutscher einstmals den erschöpften Pferden zu, um sie zu lenken.
Den Apotheken werden nun Vergütungen (die sie verständlicherweise als unzureichend ansehen) in der Größenordnung von einem Euro für den Ersatz eines verordneten, aber nicht lieferfähigen Medikamentes gegen ein ähnliches zugesagt. Weil das vielleicht mickrig scheint, soll ihnen künftig erlaubt werden, Impfungen anzubieten, gegen Grippe vor allem, und Vorsorgeuntersuchungen. Das Ausstellen von Kassenrezepten hingegen, von der Ärztin/ dem Arzt bleibt trotz der Verantwortung dafür und allem Haftungsrisiko vollkommen gratis. Darüber hinaus werden Arztpraxen künftig von besorgten Patientinnen/Patienten aufgesucht werden, nachdem sie in der Apotheke mit ihrem Gutschein vorstellig und mit ein paar Parametern vorsorgeuntersucht wurden.
Mehr Medikamente – mehr Gesundheit?
Professor Karl Lauterbachs schöne neue Gesundheitspolitik, fern von Arztpraxen, fern von Apotheken, ohne sonderliches Alltagsverständnis, vielversprechend immerhin für Patientinnen und Patienten. Die Produktion von Schmerzmitteln, Antibiotika und Fiebersäften bis zum technischen Limit steigern. Klingt äußerst entschlossen. Zwar wurde vor langer Zeit schon die übermäßige Verordnung der übermäßige Konsum gerade dieser Mittel als Gefahr für die Gesundheit erkannt. Aber jetzt gilt es, die Produktion zu steigern. Manches, um nicht zu sagen alles, in der aktuellen Gesundheitspolitik erscheint widersprüchlich.
Unbeirrt von seriösen Warnungen, trotz der Versorgungslücken hiesiger Arzneiproduktion steigt der Umsatz. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für rezeptpflichtige Medikamente erreichten mit 52,9 Milliarden Euro im vorigen Jahr einen neuen Höchststand und damit eine Steigerungsrate um 88 Prozent im Zehnjahreszeitraum der Absatz patentgeschützter Medikamente sogar um 100 Prozent. All das muss ja erst mal geschluckt werden – und dazu erstattet bzw. finanziert werden. Signifikant mehr Gesundheit scheint damit nicht entstanden zu sein. Allerdings ist die Medizin effektiver geworden. In der Dekade von 2012-2021 ist die durchschnittliche Lebenserwartung um knapp ein Jahr gestiegen, im ersten Jahr mit Corona ungefähr einen Monat rückläufig gewesen.
Überproportionaler Anstieg von Wechselwirkungen
Betreut (angebunden, wird manchmal geschrieben) von der eingreifenden, evidenzbasierten Medizin leben die Menschen im Schnitt etliche Monate länger, im Einzelfall können durchaus Jahre, sogar ein paar Jahrzehnte, erreicht werden, wertvolle Lebenszeit geschenkt werden. Dazu tragen hochwirksame Medikamente zweifellos bei. Selbstverständlich muss dabei sorgfältig auf Risiken, unerwünschte Arzneimittelwirkungen (meist als UAW abgekürzt), geachtet werden. Mit der Zahl parallel verordneter verschiedener Medikamente steigt das Risiko und die Gefahr von Wechselwirkungen in der Regel überproportional.
Mehr Symptome, mehr Medikamente
Denn nur noch selten sind Menschen, die völlig gesund sind, und noch seltener Menschen, die bloß an einer Krankheit leiden. In der zweiten Lebenshälfte sind hierzulande drei oder fünf oder mehr chronische Krankheiten eher die Regel als die Ausnahme. In Entlassbriefen von Krankenhäusern nehmen die zeilenweise aufgeführten Krankheiten (codiert, wichtig auch für die pauschalierte Vergütung) bereits eine halbe Seite und mehr ein. Ein Teil dieser Krankheiten wird als abhängig klassifiziert, das bedeutet, dass die eine chronische Krankheit die andere bedingt, beispielsweise Niereninsuffizienz von Herzinsuffizienz und/oder von Diabetes mellitus.
Je länger Patienten/Patientinnen mit chronischen Krankheiten von der Medizin erhalten werden können, umso mehr wächst logischerweise die Zahl weiterer chronischer Krankheiten, die Komorbidität. Dazu kommen oft weitere Krankheiten, die ziemlich unabhängig davon entstanden sind. All das zusammen bildet die Multimorbidität, die in unserer Gesellschaft, salopp formuliert, immer mehr „Multi" wird. Und selbstverständlich mehr Medikation erfordert. Das ist dann die Multimedikation.
Öfter mal ans Absetzen denken
Geht man davon aus, dass für jede Krankheit mindestens ein Medikament zu verordnen ist, gewöhnlich sind es zwei oder drei, dann sind das pro Patientin/Patient bestenfalls drei, in manchen Fällen auch zehn und sogar noch viel mehr Medikamente. Wobei es zusätzlich geboten ist, gegen die Nebenwirkungen des einen oder anderen Medikamentes weitere, davor schützende Medikamente zu verordnen. So ist die Skala der Multimedikation nach oben offen. Wozu noch der psychologisch verständliche Faktor kommt, dass mit leichterer Hand verschrieben und angesetzt als abgesetzt wird. Da Anglizismen in der Medizin das frühere Gelehrten-Latein ersetzt haben: Prescribing ist populärer als Deprescribing. Was irgendwie auch verständlich ist: Patienten kommen ins Krankenhaus oder die Praxis, weil sie Beschwerden und Probleme haben. Dann liegt es näher, ein Mittel anzusetzen als ein vorhandenes abzusetzen. Was durchaus mal die bessere Option sein könnte.
Zunehmende Mulitmorbidität
YGefühlt kommen immer mehr Patientinnen/ Patienten in die Hausarztpraxen – dazu in die Facharztpraxen (die heutzutage meist Zentren heißen), sowie in die Krankenhäuser, die an immer mehr Krankheiten leiden, d.h. multimorbide sind. Eigenartigerweise ist die Tendenz dazu mit der Leistungskraft, selbstverständlich auch mit der diagnostischen und technischen Potenz eingreifender Medizin weiter gewachsen. Wie auch immer. Zudem bringen etliche Patientinnen und Patienten Verdachtsdiagnosen mit, die sie im Internet, mit diversen Suchmaschinen und Foren, „recherchiert“ haben (wie sie zeitgemäß sagen). Weiteres wird derzeit „auf Covid" zurückgeführt. Unser Gesundheitsminister Professor Karl Lauterbach hat persönlich Long-Covid Patienten besondere Hilfe mit einem Sonderetat von etlichen Millionen an Euros zugesagt.
Notwendige Behandlung in ausreichendem Maß
Mit der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung vor ungefähr 150 Jahren war den Kranken die notwendige Behandlung in ausreichendem Maß zugesichert worden. Seitdem ist die Medizin leistungsfähiger und zweifellos auch (vielleicht überproportional) teurer geworden. Und die Patientinnen und Patienten wussten immer besser (erinnert von der Gesundheitsministerin im Jahr 2009, mit dem heute noch gültigen Satz des Jahres): Das steht mir zu.
Keineswegs will ich hier einseitig Politik kritisieren. Sogenannte Gesundheitspolitik. Politik, die vor allem nachhaltig und zukunftsschützend sein sollte. Auch der Medizin ist Marketing kein Fremdwort mehr. Wird vielerorts, in etlichen Zentren, praktiziert. Davon sind auch die Krankenkassen, die in heftigem Wettbewerb um die Beitragszahler stehen (den es bei der Gründung der Reichsversicherungsordnung noch nicht gab), die sich nun wohlklingender Gesundheitskassen nennen, nicht ganz frei.
So hängt alles mit allem zusammen. Wunderschöne Etiketten. Aber wie so oft ist das Ergebnis all dieser Fortschritte nicht ganz so gut. Um nicht zu sagen: problematisch. Oder: bedenklich. Und schon gar nicht zu sagen: gefährlich. Da würde keiner sagen: Das steht mir zu. Hingegen ist der Staat, die Gesellschaft, die Krankenkasse (pardon: die Gesundheitskasse), die moderne Medizin, das MRT, die Pharmazie, doch da, uns zu behüten. Was ja bestmöglich geschieht.
Überversorgung schon im Kindesalter?
Nun wächst aber der Bedarf bzw. der Verbrauch (keineswegs ist das das Gleiche, verbrauchen wir doch zunehmend mehr, als wir benötigen) an Antibiotika, Schmerzmitteln und Fiebersäften, schneller als der Nachschub aus fernen Ländern. Außerdem wächst die Multimorbidität und die Multimedikation. Gleichzeitig klagen Kinderärzte über fehlende Antibiotika und Fiebersäfte. In meiner hausärztlichen Praxis benötige ich diese Mittel auch manchmal, jedoch selten. Gerade für Kinder. Denn da wird doch die Grundlage für spätere Gesundheit erbaut, mit nachhaltiger Entwicklung des Immunsystems und der Förderung gesundheitsfördernder Darmflora. Ohne sonderliches Pipapo.
Mulitmorbidität u. -medikation: Ursache oder Wirkung?
Im Weltbild zeitgemäßer Medizin und neuester Gesundheitspolitik kann es (keinesfalls will ich sagen: darf es) eigentlich keine gesunden Menschen mehr geben. So bedenklich und problematisch diese Einsicht auch scheinen mag, leider ist es die Realität. Vielmehr angesagt ist Multimorbidität und Multimedikation. Gewiss können einige Medikamente hilfreich und sogar segensreich sein. Wenn es, ganz einfach gesagt, nicht zu viele sind, nicht zu viele sein müssen. Wenn aus der Vielzahl nicht noch weitere Risiken entstehen. Genaue Daten zu den Gefahren der Multimedikation werden aus verständlichen Gründen nicht so gern und klar publiziert, werden vielleicht auch gar nicht so gerne erfasst. Seriösen Schätzungen zufolge werden ungefähr 5 Prozent aller Krankenhauseinweisungen in Deutschland erforderlich wegen Arzneimittelnebenwirkungen, bei älteren Menschen rund 10 Prozent. Zur Relativierung sollte bewusst sein, das betrifft überwiegend chronisch vorerkrankte Patienten.
Gesundheitsversorgung muss nachhaltig werden
Multimorbide Patienten, da gilt es anzusetzen. Die Krankheitsanfälligkeit, die Krankheitsentstehung und später die Multimorbidität möglichst niedrig halten – schon von Kindheit an. Antibiotika und Schmerzmittel schon in dieser Phase restriktiv und nachhaltig, nur bei unbedingter Notwendigkeit einzusetzen, statt deren Produktion bis zum technischen Limit zu steigern. Irgendwie ist da doch ein Widerspruch. Es ist auch der Widerspruch zwischen: Das ist notwendig oder: Das steht mir zu. Mehr und mehr für die Agenda geprägt von dem vermeintlichen Mantra: das steht mir zu, statt von: das kann ich tun, das sollte ich tun, das will ich tun.
Vielmehr wird die neueste Gesundheitspolitik geprägt von der Produktion bis zum technischen Limit, gerne ausgelagert in ferne Länder. Nachhaltig und zukunftsbewahrend ist sie nicht. Allerdings ist das nicht nur in der Medizin und der Gesundheitspolitik so, es durchdringt die gesamte Gesellschaft. Und wenn sich da nichts wirklich grundlegend ändert, am Anspruch, am Fordern und am Verlangen („Das steht mir zu“) ist nicht nur die Gesundheit, sondern damit auch die Zukunft nicht zu retten. Der/die Letzte macht dann das Licht aus.
Mangel an Nachhaltigkeit zu Lasten der Betroffenen
In dieser, leider nicht unrealistischen, Vision ist die Multimorbidität und die Multimedikation bloß eine Marginalie. Für heutige Patientinnen/ Patienten ist das Problem aber höchst bedeutend. Vielleicht hätte mit rechtzeitiger Prävention, mit bewusster, naturgemäßer Ernährung, manche Erkrankung verhindert werden können. Aber nun gilt es nach vorne zu schauen, in die Zukunft. Nachhaltig zu werden, und zu bleiben. Bei bereits chronischer Erkrankung werden Maßnahmen und Mittel der eingreifenden Medizin unverzichtbar bleiben.
Deren Einsatz kann sehr hilfreich, in manchen Fällen aber auch gefährlich sein. Da gilt es abzuwägen. Einseitiger Fundamentalismus, das Propagieren von Vorurteilen, ist nicht besonders hilfreich. Verheddert sich leicht.
Notwendig ist Klarheit. Nicht aller Fortschritt ist gut. Die moderne Medizin hat große Fortschritte gemacht. Die sind notwendig und hilfreich, aber nicht die Welt rettend. Mitunter abträglich.
Gesundheit gibt es kaum noch. Trotz aller Etiketten, auf denen Gesundheit steht. Hingegen sind mehr Krankheiten entstanden. Multimorbidität. Und daraufhin Multimedikation. Einerseits hilfreich. Potenziell aber gefährlich.
USA Vorreiter auch bei Mentalität
Lange bevor sie hier ankamen, sind Gesundheitsverluste in den USA schon entstanden, dem Land, das die hiesige Zivilisation und deren Wissenschaft markant geprägt hat. Bedingt durch übermäßigen Konsum, vor allem von Zucker und tierischem Fett. Übergewicht war da die logische Folge, Arteriosklerose, Diabetes mellitus vom Typ zwei, Übergewicht, Anfälligkeit für Depressionen und Schlafstörungen, Entzündungen. Und gegen all das gibt es selbstverständlich immer mehr Medikamente. Deren Absatz und Produktion bis zum technischen Limit (von dem Herr Professor Dr. Karl Lauterbach, der in den USA studiert hatte, nun sprach) bisher wenig reduziert wurde.
Tatsächlich kann Krankheit aus Mangel entstehen/ bestehen, auch aus Mangel an Medikation, was derzeit die herrschende Überzeugung ist. Krankheit kann aber auch aus Übermaß entstehen, aus übermäßigem Fordern und Verlangen, wie auch aus übermäßiger Medikation. Was derzeit nicht beachtet wird. Wirklich sinnvoll ist Gleichgewicht. Nachhaltigkeit. Weder Hypo- noch Hypermedikation. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Die aktuelle Tendenz in unserer Gesellschaft ist aber: Viel hilft viel. So viel wie möglich. Das steht mir zu. Letzteres kann aber in allem schädlich sein.
Multimorbidität (viel Krankheit) erfordert Multimedikation (viele Mittel). Zweifellos. Dabei kann ein Medikament hilfreich sein, vielleicht noch ein weiteres und ein drittes. Oder viel mehr. Den Leitlinien evidenzbasierter Medizin entsprechend, sowie unserer Mentalität.
Unangemessen riskante Medikation
Weil die Multimedikation nicht nur nützlich ist, wurden in den fortschrittsanführenden USA PIM-Listen erstellt, in denen unangemessen riskante Medikamente (potentially inadequate medication) aufgeführt sind. Das hiesige Äquivalent dazu ist das PRISCUS-Verzeichnis, in dem 177 Medikamente mit besonderen Risiken für ältere Menschen benannt sind, samt erforderlichen Dosisanpassungen und Therapiealternativen.
Mit abnehmender körperlicher und muskulärer Aktivität, mit häufiger Fehlernährung, mit überlastetem Bindegewebe, mit schwindender Nierenfunktion, Leberfunktion und Herzmuskelleistung steigt das Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Und bei resultierender Multimorbidität auch das Risiko unerwünschter Wechselwirkungen.
Ratsam ist: So viel wie nötig. Und davon so wenig wie möglich. Höchste Priorität hat das Bewahren, bedarfsweise Wiederherstellen und Erhalten von Gesundheit. Im Basisprogramm für längere Gesundheit finden Sie Anregungen, Informationen und essentielle Mittel dazu.
Erschienen in:

Ausgabe Nr. 54 (Jan./Feb. 2024)
Multimedikation
Nicht zu wenig und nicht zu viel - dieser generelle Leitsatz von Dr. Klaus Mohr trifft auch auf das Thema Arzneimittel zu. Vor allem jetzt, in Zeiten von Lieferengpässen.