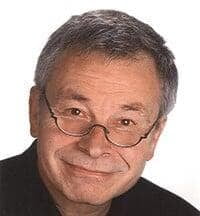Es hat nicht geholfen. Manche Behandlung wird so empfunden. Bei chronischen Erkrankungen und Funktionsstörungen nicht selten. Das muss sorgfältig geklärt und behoben werden. Anderenfalls ist Verschlimmerung der Krankheit zu befürchten sowie Resignation oder Verzweiflung
Reklamationen in der modernen Gesellschaft: Medikamente im Fokus
Manchmal wird die Bewertung es hat nicht geholfen aber auch in der Art einer Reklamation vorgetragen. In unserer Gesellschaft, im Netz, in einschlägigen Foren ist Reklamieren und Beschweren durchaus üblich geworden. Über zweifelhafte Produkte und miserable Dienstleistungen. Und eben auch über Medikamente und Therapien. Nicht immer sind die korrekt, das muss jeweils im Einzelfall geprüft werden. Ohnehin sind Medikamente keine Konsumartikel, sollten es zumindest nicht sein
Die zwei Seiten der Medikamentenwirkung: Patient und Arzneimittel
Bei Medikamenten ist mehr zu beachten. An der Wirkung sind zwei Seiten in unterschiedlichen Anteilen beteiligt: auf der einen Seite die Patientin/der Patient, auf der anderen Seite das Medikament. Wobei selbstverständlich das Medikament für die Patienten da sein sollte, nicht umgekehrt. Letzteres wird immer mal wieder in kritischen Artikeln über die pharmazeutische Forschung und ArzneimittelHersteller unterstellt. Da gelten Patienten als Konsumenten und Opfer industrialisierter, profitsüchtiger Medizin.
Medizin als Dienstleistung: Herausforderungen und Erwartungen
Beides sollten sie nicht werden. Weder Konsument noch Opfer. Inzwischen ist aber, objektiv betrachtet, die Medizin zum Dienstleistungsbetrieb entwickelt worden: spezialisiert und zertifiziert.

Medikamente als Hauptmittel der evidenzbasierten Medizin
Zur Behandlung der Krankheiten sowie ihrer Folgen, zur Linderung sämtlicher Schmerzen und Störungen, zur Versorgung der Kranken sind Medikamente das Hauptmittel des medizinischen Managements.
Hauptmittel der evidenzbasierten, eingreifenden Medizin – die zweifellos hocheffizient ist, hochwirksam. Problem nur: daraus entsteht keine Heilung – es sei denn durch Wunder. Das sollte jetzt nicht gleich abgestritten, auch nicht verklärt, und nicht als Magie, Zauberei, Esoterik abgetan werden. Rationaler ist: durch Selbstheilung. Willst Du gesund werden? Willst Du geheilt werden? fragt uns das Evangelium. Anleitung zur gedanklichen Linderung von Leiden findet sich in Buddhas Philosophie, seiner Lehre der Selbstlosigkeit (falls gewünscht, | 13 genauer erklärt in einem eventuell folgenden Beitrag von reformleben).
Die Rolle der Medikamente in der modernen Gesellschaft
In unserer Zeit, unserer Gesellschaft, ist jedoch Selbstlosigkeit selten – und Medizin völlig unverzichtbar (obgleich kaum noch bezahlbar). Hauptmittel dieser Medizin ist das Medikament. Genauer gesagt, eine Fülle von Medikamenten, deren Wirksamkeit mit aufwendigen, teuren Experimenten (Studien) nachgewiesen, damit objektiviert wurde. Große Fortschritte in der Behandlung vieler Krankheiten konnten damit erreicht werden. Fortschritte auch im Begegnen unerwünschter Wirkungen (Nebenwirkungen). In unserer bisher sehr wohl versorgten Gesellschaft ist bestmögliche Wirkung fast schon eine Art von Rechtsanspruch. Zunehmend stehen nun Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten im Fokus.
Arzneimittelwirkung: Erwartungen vs. Realität
In Arzneimittel werden gebraucht zum Behandeln von Krankheiten, zum Beheben von Störungen, zur Besserung von Funktionen, zum Lindern von Schmerzen und anderen Nöten, zum Mindern von Erkrankungsgefahr. Mehr und mehr auch für Lifestyle und Wellness. Was bedeutet da: es hat nicht geholfen? War es unwirksam, hat es die Erwartungen nicht erfüllt?
Evidenzbasierte Medizin: Nutzen vs. Risiko
Allerdings haben Arzneimittel mehr oder weniger zahlreich auch unerwünschte Wirkungen, sogenannte Nebenwirkungen. Grundsätzlich – das ist die selbstverständliche Voraussetzung der behördlichen Zulassung jedes eingreifenden Mittels – muss der potentielle Nutzen das potentielle Risiko signifikant überwiegen.
Die Kosten der evidenzbasierten Medizin
Um Schaden nach Möglichkeit zu verhindern, wie er etwa durch Contergan verursacht war, hat die Medizin unserer Zeit, die eingreifende Medizin, sich die Evidenzbasierung verordnet. Evidenzbasiert heißt: mittels großer, vorurteilsfrei geplanter, randomisierter, reproduzierbarer, multizentrischer, doppelblinder Anwendungsstudien nachgewiesen und überprüft. Der hohe, auch finanzielle, Aufwand ist für neue synthetische eingreifende Mittel absolut unverzichtbar. Und preistreibend.
Medikamentenkosten von 3-10 Euro pro Tag, öfters noch viel mehr, wachsen weiter. Demgegenüber steht „Benefit“. Dass es hilft. Zu lindern, womöglich zu heilen, zu leben.
Heilung vs. Symptomlinderung: Was kann die evidenzbasierte Medizin leisten?
In der Heilung und Gesundheit im ursprünglichen Sinn verspricht die evidenzbasierte Medizin allerdings nicht. Beides kann mit Medikamenten allein nicht hergestellt werden. Evidenzbasierte Medizin ist fokussiert auf die objektive Wirkung ihrer Mittel: in welchem Ausmaß konnte/kann Krankheit damit reduziert werden? Wie viele Komplikationen, wie viele Krankenhauseinweisungen, wurden statistisch verhindert? Konnte Selbstständigkeit bewahrt und Pflegebedürftigkeit abgewendet werden? Daran wird die Medizin gemessen. Zumal die Kosten gerade der neu zugelassenen Medikamente außerordentlich hoch sind, wodurch die Ausgaben, daher auch Beitragssätze der Krankenkassen weiterhin steigen. Ohne Milliardenzuwendungen aus dem Steueraufkommen könnte das System viele Leistungen nicht mehr erbringen.
Die Bedeutung der objektiven Wirkung in der Medizin
Grund: Der Einsatz evidenzbasierter Medizin, ungeachtet hoher Kosten, ist begründet und gerechtfertigt mit den objektiven Wirkungen, die in Zulassungsstudien nachgewiesen sind.

Warum die objektive Wirkung nicht immer ausreicht
Viele von Ihnen werden aber schon erfahren haben, dass die objektive Wirkung nicht immer so eintritt, wie sie im Buch, bzw. auf dem Beipackzettel steht. Unbedingt muss dann geklärt werden, ob das Mittel richtig angewendet wurde; ob es zur Behandlung der Krankheit, für die bestehende Indikation wirklich geeignet ist; ob es ein gleich oder besser geeignetes Mittel gibt. Der Spruch aus früheren Zeiten: gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, wird heute gern relativiert. Vielmehr wird das Heil in der Entwicklung neuer, meist synthetischer Wirkstoffe gesehen. Zweifellos ist die Medizin damit eingreifender und effektiver geworden. Daher ist die Hoffnung entstanden, künftig könne jede Krankheit sicher und schnell behoben werden. Einiges wurde schon erreicht, wenngleich mit sehr hohem Aufwand. Damit sind aber auch die Erwartungen in der Gesellschaft enorm gestiegen. Mehr noch als die Bereitschaft zur Selbstbeteiligung. Und Mitverantwortung.
Die Erwartungen an die Medizin sind hoch und fast genauso hoch, manchmal noch höher, sind die Zweifel daran. Die Beziehung ist zwiespältig. Einerseits wird Hilfe erwartet, mehr noch: verlangt und gefordert. Andererseits wird sie beschuldigt. Zu wenig wirksam zu sein, oder zu stark. Mitunter mehr Schaden als Nutzen zu bereiten. Arg teuer zu sein.
Die Rolle der individuellen biologischen Unterschiede
Heilung und GesunNatürlich wirkt jedes Mittel bei jedem Menschen ein klein wenig anders, als die Studienergebnisse besagen. Besser oder schlechter, stärker oder schwächer, belastender oder entlastender. Das liegt nicht am Medikament allein, sondern vielmehr an der Interaktion zwischen Arzneimittel und Organismus. Alle Menschen sind gleich, jedoch ist keiner genauso
wie der andere. Dadurch ist auch die genannte Interaktion nicht immer gleich. Biologische Variabilität kann statistisch mit der Gaußschen Normalverteilung, in grafischer Darstellung, der bekannten Glockenkurve prognostiziert werden. Der zufolge ist die Wahrscheinlichkeit einer geringen Abweichung des jeweiligen Merkmals bei ungefähr 4,55 Prozent jeder Population, und eine ausgeprägte Abweichung bei ca. 0,27 Prozent anzunehmen. In der Praxis finden sich allerdings markant höhere Abweichungen von den theoretisch zu erwartenden objektiven Wirkungen, sowie von den Nebenwirkungsquoten.
Subjektive vs. objektive Wirkung: Was zählt wirklich?
Um dies zu verstehen, müssen wir neben der objektiven Wirkung auch die subjektive Wirkung erkennen. Objektiv steht da für real, d.h. wirklich. Wobei wirkliche Wirkung sich schon ein wenig schräg anhört, redundant oder tautologisch, wie kleiner Zwerg, oder großer Riese. Doch zweifellos ist die objektive Wirkung real, vorhanden, obgleich sie von Mensch zu Mensch ein wenig, mitunter auch etwas mehr variiert – biologisch, statistisch.
Die Interaktion von Medikament und Organismus
Wenn es aber allein diese Wirkung gäbe, müssten wir nicht jedes Mal dazu sagen: objektiv. Offenbar gibt es noch eine andere. Nämlich die subjektive Wirkung. Aber wie ist die nun zu verstehen? Klar ist: der evidenzbasierten Medizin ist sie manchmal ein Dorn im Auge. Im Patienten kann die objektive Wirkung durch die subjektive Wirkung verändert werden, vermindert aber auch verstärkt. Als Placeboeffekt wird das wissenschaftlich überschrieben (s. reformleben Nr. 52 – Die Wirksamkeit von Placebo). Oder Noceboeffekt, je nach Richtung und Art.

Die Rolle der Erwartungen und Hoffnungen des Patienten
Objektiv steht für real, so wie es in Studien nachgewiesen wurde. Subjektiv ist, was im einzelnen Patienten geschieht und empfunden wird. Die objektive Wirkung ist, völlig korrekt, die Grundlage evidenzbasierter und eingreifender Medizin. Alles, was nicht objektiv gesichert ist, gilt da grundsätzlich als unwirksam, und ungültig. Ist demnach das, was wir selbst empfinden und spüren, dass wir subjektiv fühlen, nun irrelevant, irreführend? Bestimmt nicht. Wenn Ihnen bewusst ist, dass es diese beiden Wirkarten gibt, können Sie Therapie besser bewerten und sich besser orientieren. Problematisch ist es, wenn die beiden Arten verwechselt werden – oder, was häufig geschieht, gegeneinander ausgespielt werden.
Wer oder was hilft uns wirklich?
Im Idealfall sollte die subjektive Wirkung mit der objektiven übereinstimmen. Dann kann die Behandlung fortgesetzt werden, erfolgreich. Gerade bei chronischen und funktionellen Erkrankungen ist das aber oft nicht so. Dann fühlen sich Patienten unzureichend oder völlig verkehrt behandelt. Was selbstverständlich geklärt und evaluiert werden muss: welchen Nutzen, welches Ziel hat die Behandlung? Welche Wege gibt es, dieses Ziel zu erreichen? Welcher davon ist allgemein, und welcher individuell besser geeignet? Wie ist die Nutzen-/ Risikoabwägung? Welches Risiko/welche Belastung möchte vom Patienten/der Patientin in Kauf genommen werden – und welches Risiko/Belastung keinesfalls? Wie weit ist die betreffende Krankheit überhaupt therapierbar?
Selbstverständlich sollten all diese Fragen schon im Vorfeld beantwortet sein – und falls das, aus welchen Gründen auch immer, nicht geschehen ist, müssen die Antworten jetzt gegeben und besprochen werden: wenn die
Patientin/der Patient an der Behandlung zweifelt. Und sagt es hilft nicht bzw. es hat nicht geholfen. Die Therapie samt Ergebnis sollte bestmöglich sein. Letzteres kann aber leider nicht bei jeder Erkrankung absolut der Erwartung entsprechen. Selbstverständlich sollte die Medizin stets ihr Bestes bringen und leisten (das ja mitunter, zunehmend häufig angezweifelt wird), eingreifend, evidenzbasiert (s.o.). Aber auch dann wird nur ganz selten ein Wunder geschehen. Vielmehr ist kompetente, seriöse, zuverlässige, vertrauenswürdige, maßvolle Diagnostik und therapeutische Arbeit die Methode der Wahl. Die nicht einseitig bleiben darf.
Die Rolle der Patienten bei der Medikamentenwirkung
Zunehmend wird therapeutische Wirkung im Einsatz der neuesten Apparate, der neuesten
Medikamente in der neuesten Technik gesucht. Hier und da mal erfolgreich, jedoch nicht immer und nachhaltig. Kein Wunder. Auch deshalb kommt manchmal die Mitteilung es hat nicht geholfen. Was hat gefehlt? Was fehlt manchmal auch in der evidenzbasierten Medizin? Vielleicht das Verstehen und Einbeziehen auch subjektiver Wirkung. Wenn es daran fehlt, werden Patienten, vor allem bei „Therapieresistenz“ (wenn es nicht geholfen hat) üblicherweise an die Psychotherapie delegiert. Auch wegen des daraus entstehenden hohen Bedarfes müssen Patientinnen/Patienten da lange anstehen, d.h. auf einen Termin warten. Wenn Sie den letztendlich erhalten, wird aber auch nicht gleich ein Wunder geschehen. Günstigenfalls aber dann ein Bewusstsein dafür, was objektiv ist und was subjektiv, und was getan werden kann, was zu tun ist, um das zu vereinen.
Selbstbeteiligung und Mitverantwortung in der Medizin
Einigkeit aber scheint in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit völlig verloren gegangen und kaum noch erreichbar zu sein. Wir sind dafür, dass wir dagegen sind. Das Sponti-Prinzip beschreibt unsere Gesellschaft und deren seit etlichen Jahren daraus resultierende Politik. Sinnvoller wäre konstruktives Miteinander. Selbstbeteiligung. Dazu Sparsamkeit, sparsamer Einsatz von Ressourcen, auch in der Medizin. Was nicht bedeutet, Notwendiges zu unterlassen, wohl aber Überflüssiges. In der Wohlstandsgesellschaft geschieht viel Unnötiges. Viele Menschen wollen immer mehr, statt weniger. Etliche Zivilisationskrankheiten – sowie Umweltschäden – entstehen aus Übermaß.
Woher auch immer, jede Krankheit erfordert bestmögliche Therapie. Wenn deren Wirkung unzureichend ist – oder erscheint, wird selbstverständlich zuerst das Medikament und dessen Eignung infrage gestellt, wie oben schon dargelegt. Letztlich ist aber die Interaktion zwischen Wirkstoff und Organismus entscheidend. Aufgrund großer Fortschritte der eingreifenden Medizin neigen Patienten wie Ärzte dazu, sehr einseitig auf das Medikament zu setzen, und weniger auf die Interaktion. Weniger auch darauf, was in den Patienten gleichzeitig mental geschieht.
Weil die neuen Mittel und Maßnahmen so effektiv wurden, schien die Mitwirkung der Patienten und deren Selbstbeteiligung weniger notwendig zu sein. Ohnehin wird Selbstbeteiligung im Bereich der Solidar- und Sozialkassen meist als finanzielle Beteiligung verstanden – und folglich abgelehnt. Hier geht es aber um Anderes als das liebe Geld, viel mehr um Wesentliches. Selbstbeteiligung bedeutet erst mal Einverständnis mit den für richtig erachteten Mitteln und Maßnahmen. Bedeutet Übereinstimmung, und Mitwirkung: körperlich und mental, eine gesunde Lebensweise, und Einstellung. Zielorientierung: Gesundheit und Heilung. Mitunter fehlt es an diesen Komponenten. Die bringt kein Mittel von sich aus mit, auch wenn die objektive Wirkung noch so gesichert ist.
Natürliche Mittel und ihre Bedeutung in der Medizin
Nicht nur emotional, sondern auch rational ist die Übereinstimmung mit bewährten natürlichen Mitteln meist stärker. Weil diese Mittel, von Pflanzen entwickelt und gebildet, seit einigen hunderttausend Jahren in der Welt sind, daher unseren Zellen vertraut. Einige Pflanzenarten sind, zum Schutz unserer Gesundheit, geradezu essenziell. Bezeichnenderweise stimmt da die objektive Wirkung mit der wohltuend empfundenen subjektiven Wirkung gut überein. So kann manche Krankheit verhütet und die Gesundheit länger bewahrt werden.
Dr. med. Klaus Mohr
Erschienen in:

Ausgabe Nr. 61 (März/April 2025)
Zurück auf Normal
Die ursprüngliche Kraft einer kohlenhydratarmen Ernährung